Im KI-Labor
Zum AnfangEntdecke die Zukunft von Bioökonomie & KI
Künstliche Intelligenz ist dabei längst fester Bestandteil der Forschung und ein echter Beschleuniger. Sie hilft, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen, Prozesse effizienter zu gestalten und ganz neue Ideen zum Leben zu erwecken.
Komm mit auf Entdeckungsreise!
Schau Dich in unserem KI-Labor um, sammle spannende Infos und lass Dich von neuen Perspektiven inspirieren.
Optimierte Aquakultur
Zum AnfangOptimierte Aquakultur
Eine nachhaltige Alternative dagegen können moderne Aquakultursysteme sein, in denen Fisch ressourcenschonend gezüchtet wird. Künstliche Intelligenz kann helfen diese Anlagen zu optimieren, sie ökologisch und ökonomisch nachhaltiger zu gestalten. So wird der Weg hin zu einer zukunftsfähigen Versorgung mit Fischprodukten geebnet.
Seefisch vom Land
Um die Anlagen weiterzuentwickeln, kooperiert Seawater Cubes mit Forschungseinrichtungen in mehreren Projekten. So wurde zusammen mit dem August-Wilhelm Scheer Institut der Frage nachgegangen, wie Künstliche Intelligenz helfen kann, Aquakultur ressourcenschonender und wirtschaftlich lukrativer zu machen.
Rezirkulierende Kreislaufanlagen
Etwa 15.000 Fische schwimmen in drei Abschnitten in den Tanks: Salzwasser-Arten wie Dorade und Wolfsbarsch, die natürlicherweise im Schwarm vorkommen. Das Wasser wird in den rezirkulierenden Kreislaufanlagen fortwährend aufbereitet, 99% wird wiederverwendet und bleibt im System. Ausscheidungen und Futterreste werden mit verschiedenen technischen Verfahren herausgefiltert. Denn eine gute Wasserqualität ist entscheidend, um gesunde, qualitativ hochwertige Fische zu züchten, auch ohne den Einsatz von Medikamenten.
Klick auf Play ...... und schau, wie die Anlagen funktionieren.
FishAI – KI im Einsatz
Bisherige Fütterungssysteme für Aquakulturanlagen basieren auf statischen Wachstumsmodellen, ohne das tatsächliche Wachstum und Futterverhalten der Fische miteinzubeziehen. So kann bei Abweichungen nicht mit einer Anpassung der Futtermenge reagiert werden.
Mit Hilfe autonomer Sensoren der smarten Bilderkennung kann die Biomasse der Fische bestimmt werden, akustische Sensoren können zudem Rückschluss auf die Futteraufnahme geben.
So kann ein intelligentes, datenbasiertes Fütterungssystem den Einsatz von Futtermitteln effizienter gestalten – und somit Kosten sparen, während gleichzeitig die Produktivität der Anlagen steigt.
AudiokommentarLaura BiesForscherin am August-Wilhelm Scheer Institut
FishSizer - How big is the fish?
Kombiniert mit Metadaten, die Auskunft über Charakteristika der Fischart und Haltungsbedingungen, wie Temperatur oder pH-Wert geben, können dynamische Wachstumsmodelle erstellt werden. So können präzise Prognosen für die Futterzufuhr geliefert und Vorhersagen gemacht werden, wieviele Fische, wann und in welcher Größe für die Vermarktung zu Verfügung stehen.

Bioökonomie erleben: Algenfutter in Aquakulturen
Wie kann Fischzucht nachhaltiger werden? In unserem Format „Bioökonomie erleben“ ist Reporterin Margarita A. Milidakis zu Besuch beim Fraunhofer IMTE in Büsum. Dort wird an modernen Aquakultursystemen geforscht, die mit minimalem Frischwassereinsatz auskommen und die Gesundheit der Fische in den Mittelpunkt stellen.
Der Laborfischer - Sebastian Rakers
Speisefisch, den man nicht fischen muss: Mit seinem Start-up Bluu Seafood züchtet Sebastian Rakers zellbasierten Fisch im Bioreaktor – als erstes Unternehmen in Deutschland und Europa. Dieses Video aus der Porträtreihe DIE BIOPIONIERE zeigt einen Visionär, der mit seiner Forschung dazu beiträgt, die überfischten Meere wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Mit Mikroalgen nachhaltiges Fischfutter erzeugen
Bioverfahrenstechniker der TU Berlin zeigen, wie die Fischzucht in Aquakulturen nachhaltiger werden kann. Dafür wurden Omega-3-Fettsäuren für Fischfutter aus pflanzlichen Reststoffen und mithilfe von Bakterien und Algen gewonnen, die Fischmehl und -öl ersetzen können.
Nachhaltiges Fischfutter für Aquakulturen
Alternative Proteinquellen wie Insektenmehl als Fischfutter können nicht nur die Aufzucht in Aquakulturen nachhaltiger machen, sondern auch das Wachstum und den Nährstoffgehalt von Fischen positiv beeinflussen. Das zeigt eine Studie von Forschenden des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei.
FishAI - Das Forschungsprojekt
Nachhaltige Versorgung mit Fischprodukten durch rezirkulierende Aquakultursysteme, unterstützt von einem intelligenten Fütterungssystem und autonomen Sensoren zur Biomassenbestimmung.
Mit dem Forschungsprojekt FishAI soll die Wirtschaftlichkeit von RAS Anlagen gesteigert und damit eine nachhaltige Versorgung mit Fischprodukten in Deutschland gemäß der NASTAQ Ziele für 2030 etabliert werden.
Hier geht es: Zurück ins Labor... und zu den anderen Kapiteln

Materialien der Zukunft
Doch ihr Weg von der Idee bis zur Anwendung ist oft langwierig, kostenintensiv und von zahlreichen Versuchsreihen geprägt. Dadurch bleiben selbst vielversprechende Ansätze häufig auf der Strecke.
Automatisierte Labore und der Einsatz Künstlicher Intelligenz revolutionieren diesen Prozess und ermöglichen eine bislang unerreichte Beschleunigung. Lernfähige Modelle können gezielt Materialien mit gewünschten Eigenschaften entwerfen und deren Herstellung effizient optimieren – ein entscheidender Schritt hin zu einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen Materialproduktion.
Ein neues, KI-gestütztes Chemieunternehmen

Nach der erfolgreichen Entwicklung von veganen Kollagenprodukten für Haut und Haar, arbeitet das Team um die Gründer Mitchell Duffy und Charly Cotton inzwischen auch an biobasierten Alternativen für die Modeindustrie – etwa an Polymeren für Turnschuhsohlen oder neuartige Textilbeschichtungen.
Möglich macht es die konsequente Automatisierung und der Einsatz Künstlicher Intelligenz. KI begleitet den gesamten Entwicklungsprozess – vom Design neuer Proteine oder Polymere über die Konstruktion der mikrobiellen „Fabriken“, bis hin zur Skalierung des Bioprozesses. Jeder dieser Schritte lässt sich mithilfe lernender Modelle vorhersagen und optimieren.
AudiokommentarMitchell DuffyMitgründer & CEO von Cambrium
Design mit Blick auf den Markt
Schon beim Design müssen daher verschiedene Kriterien mitgedacht werden:
Das neue Protein oder Polymer muss die gleichen Eigenschaften wie das petrochemische oder tierische Vorbild besitzen – im Idealfall sogar besser sein, damit Unternehmen einen echten Anreiz haben, ihr bisheriges Material zu ersetzen.
Es muss skalierbar sein: Ein Hochleistungsprotein, das sich nicht in größeren Mengen produzieren lässt, kann den Markt nicht erreichen.
Und es muss sich nahtlos in die Produktionsprozesse der Kunden einfügen, ohne dass diese ihre Anlagen oder Abläufe grundlegend ändern müssen.
Nur wenn all diese Faktoren erfüllt sind, hat das Material echte Chancen, im Markt erfolgreich eingesetzt zu werden.
KI als Produktentwickler – Proteine digital designen
KI ist dabei entscheidend, um unter nahezu unendlich vielen Möglichkeiten der Proteinfaltung jene zu identifizieren, die die gewünschte Funktion erfüllen. So können Tausende Varianten virtuell durchgerechnet werden. Nur die vielversprechendsten werden anschließend im Labor tatsächlich getestet.
Vom Algorithmus ins Labor
Im Labor wird dabei nicht nur getestet, welches Protein die besten Eigenschaften zeigt, sondern auch, wie effizient die Hefen produzieren und wie sich der Bioprozess skalieren lässt – Aspekte, die bereits in der Modellierung mitgedacht wurden.
Mit Hochdurchsatzverfahren können zahlreiche Varianten parallel untersucht werden. Die dabei entstehenden Daten fließen kontinuierlich in die Modelle zurück und verbessern deren Vorhersagen. So entsteht ein Kreislauf aus Analyse, Experiment und Optimierung, der die Entwicklung erheblich beschleunigt.
Auf diese Weise gelingt es Cambrium, Entwicklungszyklen, die früher Wochen oder Monate dauerten, auf Tage bis wenige Wochen zu verkürzen.
Neues Zeitalter der Materialinnovation
Die Entwicklung solcher Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen wird durch lernfähige Algorithmen auf ein neues Niveau gehoben – es bleibt abzuwarten, welche Möglichkeiten die Weiterentwicklung der Modelle und die Optimierung der Prozesse eröffnen werden.
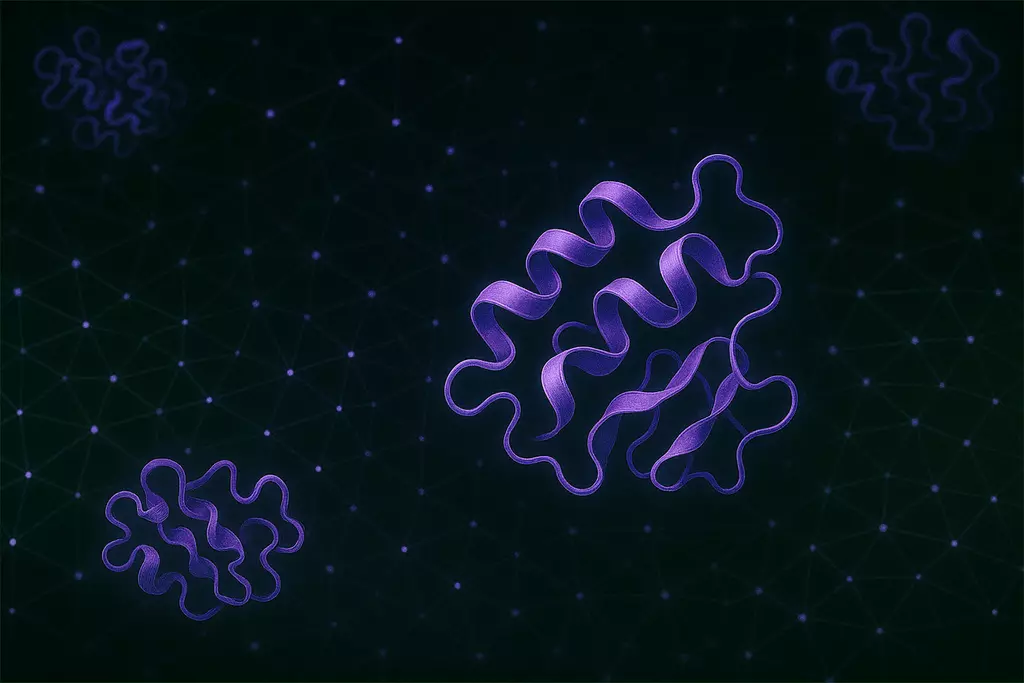
Mitchell Duffy - Der Proteindesigner
Mitchell Duffy, CEO von Cambrium, in einer Folge unserer Reihe Biopioniere.
„Der Proteindesigner“ nimmt uns mit in seine Welt der neuen Materialien – und spannt den Bogen von der kambrischen Explosion bis in die Gegenwart, in der KI den Beginn einer neuen Ära materialwissenschaftlicher Innovation markiert.
Biofunktionsbausteine für nachhaltige Materialien
In unserem Format „Bioökonomie erleben“ ist Reporterin Margarita zu Besuch bei Professor Ulrich Schwaneberg an der RWTH Aachen und zeigt, wie sich Materialien entwickeln lassen, die wasserabweisend, funktional und gleichzeitig umweltfreundlich sind.
„Unsere generative KI spricht die Sprache der Proteine“
Interview mit Birte Höcker. Die Biochemikerin von der Universität Bayreuth nutzt Künstliche Intelligenz für die Herstellung maßgeschneiderter Proteine – und spricht über das Potenzial von Sprachmodellen, die ähnlich wie ChatGPT funktionieren.
Textilbeschichtungen aus Lignin
Im EU-Projekt BioFibreLoop entwickeln Forschende Textilmuster und Beschichtungen aus nachwachsenden und recycelbaren Materialien – darunter für Outdoorkleidung.
Multimedia-Story: Der Textilcampus
In unserer Multimedia-Story werden Beispiele für neuartige Materialien für Mode und Accessoires vorgestellt. Um
den negativen Auswirkungen der globalen Modeindustrie zu begegnen, hält die Bioökonomie zahlreiche
Lösungsansätze bereit. Eine Auswahl kann man auf dem "Textilcampus" entdecken.
Mit KI Enzyme im Meer aufspüren
Im Projekt AI MareExplore wollen Forschende von vier Helmholtz-Zentren mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) nach marinen Biokatalysatoren suchen, die Plastik abbauen oder Kohlendioxid binden können.
Hier geht es:Zurück ins Labor... und zu den anderen Kapiteln

Digitaler Zwilling
Was im kleinen Maßstab funktioniert, scheitert oft an der Skalierung. Die Entwicklung effizienter und wirtschaftlicher Bioprozesse ist komplex: Mikroorganismen, Nährmedien und Fermentationsbedingungen müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Wird dieses Zusammenspiel nicht optimal getroffen, bleibt viel Potenzial ungenutzt – und Bioprodukte werden zu teuer, um mit konventionellen Alternativen zu konkurrieren, selbst wenn sie qualitativ überlegen sind.
Mit automatisierten Laborexperimenten und Künstlicher Intelligenz lässt sich die Prozessentwicklung heute deutlich beschleunigen. Zahlreiche Parameter können parallel getestet und analysiert werden. So lassen sich optimale Produktionsbedingungen mit einer Art digitalem Zwilling zunächst virtuell vorhersagen, bevor die vielversprechendsten Ansätze im Bioreaktor umgesetzt und für die Produktion skaliert werden.
Prozessoptimierung für biobasierte Produkte
In einem automatisierten Kreislauf aus robotergestützten Hochdurchsatz-Experimenten, Datenanalyse und KI-Modellen werden die effizientesten Prozessbedingungen schneller, präziser und kostengünstiger identifiziert, als es mit klassischen, manuellen Methoden möglich ist. Die Plattform lernt aus jedem Experiment. Über Modellanpassungen werden die Vorhersagen fortlaufend präsziser und können auch für anspruchsvolle Mikroorganismen robuste, skalierbare Prozessbedingungen identifizieren.
VideokommentarChristian SpierMitgründer & CEO von Differential Bio
KI-gestützter Entwicklungszyklus
Um die optimalen Bedingungen zu identifizieren, unter denen Mikroorganismen ihr volles Potenzial entfalten, hat Differential Bio einen Entwicklungszyklus geschaffen. Er kombiniert physische Experimente mit virtuellen Vorhersagen und testet gezielt unterschiedliche Fermentationsbedingungen, um Prozesse schneller, präziser und effizienter zu optimieren.
Hochdurchsatz statt Handarbeit
In einem Durchlauf werden parallel über 30-mal so viele Experimente wie in einem manuellen Setup getestet, verteilt auf mehrere Dutzend 96-Well-Platten – und das in einer Messfrequenz, die per Hand undenkbar wäre.
Diese Kombination aus präziser Automatisierung, standardisierten Inkubationsbedingungen und hoher Messfrequenz liefert die Datenqualität, die präzise KI-Modelle überhaupt erst ermöglicht.
"In silico" ersetzt Trial-and-Error
Die KI-Modelle ermöglichen dabei eine Optimierung entlang mehrerer Ziele – etwa Produktionsoutput, Kosten, Anzahl der Zutaten oder Anteil pflanzlicher Komponenten. So lassen sich Formulierungen finden, die biologisch effektiv und gleichzeitig wirtschaftlich und praktisch umsetzbar sind.
Die besten Kandidaten werden nun im Labor-Bioreaktor getestet. Bei Bedarf wird der Algorithmus mit den neuerlichen Daten nachgeschärft. Anschließend werden die vielversprechendsten Konfigurationen auch im größeren Maßstab validiert, um sicherzustellen, dass die Leistung auch bei der Skalierung zuverlässig und robust bleibt.
Virtuelle Modelle für eine biobasierte Zukunft
Das Prinzip digitaler Zwillinge reicht weit über die Prozessentwicklung hinaus. Auch in der Landwirtschaft, bei der Züchtung neuer Pflanzen oder der Planung nachhaltiger Produktionsketten können Vorhersagen und Simulationen helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen und Entscheidungen datenbasiert zu treffen.
Virtuelle Modelle machen komplexe biologische Systeme berechenbarer – und damit gestaltbarer. Indem sie Experimente, Produktion und Auswertung enger miteinander verknüpfen, tragen solche digitalen Werkzeuge dazu bei, Innovationen schneller, präziser und nachhaltiger umzusetzen. Sie sind kein Ersatz für reale Versuche, aber ein starkes Werkzeug, um sie gezielter und effizienter zu gestalten – und damit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vernetzten, lernenden Bioökonomie.

Digitale Zwillinge in der Bioökonomie
Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts oder Systems, die in Echtzeit mit Daten aus der realen Welt oder aus Simulationsläufen aktualisiert wird. Dieser Kurzbericht erläutert, wie digitale Zwillinge funktionieren und in welcher Weise sie in der Bioökonomie eingesetzt werden.
Multimedia-Story: Entdeckungstour durch eine Bioraffinerie
Bioraffinerien sind die nachhaltigen Fabriken der Zukunft: Aus pflanzlichen Reststoffen werden hier Chemikalien als Bausteine von Alltagsprodukten hergestellt. Wie das Innenleben einer Bioraffinerie funktioniert, veranschaulicht die fünfteilige Multimedia-Story von bioökonomie.de.
Bioprozesse durch Künstliche Intelligenz optimieren
Das Heidelberger Biotechnologieunternehmen The Cultivated B stellt KI-unterstützte Biosensoren vor, die eine Echtzeit-Überwachung von Bioreaktoren und eine automatisierte Datenanalyse ermöglichen sollen.
Animation: Nachhaltige Bioraffinerien
Unsere Animation zeigt, wie in nachhaltigen Bioraffinierien Biomasse in Produkte umgewandelt wird, die bisher aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurden. Mit Technologien, wie der "Konvergierenden Konversion" wird die Verwertung der nachwachsenden Rohstoffe immer effizienter.
Finanzierung ebnet Weg für effizientere Bioproduktion
Das Münchner Start-up Differential Bio hat eine Finanzierung in Höhe von 2 Mio. Euro erhalten, um die Bioproduktion mithilfe seiner virtuellen Skalierungsplattform zu optimieren.
Hier geht es: Zurück ins Labor... und zu den anderen Kapiteln

KI in der Landwirtschaft
Mit dem DFG-geförderten interdisziplinären Excellenzcluster PhenoRob – Robotics and Phenotyping for Sustainable Crop Production der Universität Bonn und des Forschungszentrums Jülich sollen Antworten gefunden werden. Ziel ist es, die Nutzpflanzenproduktion mithilfe modernster Technologien effizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Zum Einsatz kommen dafür neben Feldrobotern und Drohnen, auch Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz.
Schwarmintelligenz für die Pflanzenproduktion
Durch die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit sollen ein ganzheitliches Verständnis für zukunftsfähige Agrarsysteme geschaffen und praxisrelevante Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft entwickelt werden. Dabei werden ökologische, ökonomische sowie gesellschaftliche und politische Perspektiven gleichermaßen berücksichtigt. Anfang 2026 startet das Projekt in seine zweite Phase.
Robotik und KI
Dank sensorbasierter Phänotypisierung können Krankheiten oder Nährstoffmängel einzelner Pflanzen automatisiert erkannt und gezielt behandelt werden. Auch Unkräuter lassen sich identifizieren und werden – je nach ihrer ökologischen Funktion – entfernt oder stehengelassen. Die Technik ermöglicht es zudem, dieselbe Pflanze über die gesamte Saison hinweg zu beobachten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können in der Pflanzenzüchtung genutzt werden, etwa um widerstandsfähigere Sorten zu entwickeln. Auf Basis der gesammelten Daten lassen sich außerdem Modelle zur Vorhersage von Wachstum und Ertrag erstellen.
Automatisierte Blattinspektion von Nutzpflanzen
Ökologische Effekte im Blick
Mithilfe der gesammelten Daten über Pflanzen, Böden und Tierarten werden die ökologischen Effekte unterschiedlicher Bewirtschaftungsmethoden sichtbar. So kann erforscht werden, wie sich eine reduzierte Bodenbearbeitung, Präzisionsdüngung oder der Einsatz von Mischkulturen auf die Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit auswirken.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen können effiziente Anbausysteme gestaltet werden, die einen stärkeren Schutz der Umwelt und Artenvielfalt ermöglichen.
Lernfähige Algorithmen für die Biodiversität
AudiokommentarProf. Dr.-Ing. Ribana RoscherInstitut für Geodäsie und Geoinformation IGG an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Aus der Forschung in die Praxis
Das Start-Up DynamoBot, eine Ausgründung aus PhenoRob, sorgt mit einem praxisnahen Feldroboter für diesen wichtigen Schritt und ermöglicht den Transfer aus der Forschung in die Praxis.

Bioökonomie erleben: Zu Besuch auf dem Innohof
Wie sieht der Bauernhof der Zukunft aus? In unserm Format „Bioökonomie erleben“ ist Reporterin Margarita dieses Mal zu Besuch auf dem Leibniz-Innovationshof (InnoHof) in Brandenburg. Sie lernt zwei innovative Projekte kennen und erfährt, wie mithilfe modernster Technologien wie Sensoren, Drohnen und KI die Landwirtschaft nachhaltiger und effizienter gestaltet werden kann.
Zukunftslabor Agrar: Kleine Felder und smarte Helfer
Das Projekt „Zukunftslabor Agrar“ präsentiert erste Ergebnisse zum Konzept des sogenannten Spot Farming und zeigt darin Potenziale, aber auch aktuelle Hindernisse für dessen Einsatz auf.
Automatisierter und punktueller Pflanzenschutz
Ein bayrisches Forschungsteam zeigt auf, wie Pflanzenschutzmittel mit Drohnen und Künstlicher Intelligenz effizienter eingesetzt werden können.
Klimaresilientes Quinoa gezüchtet
Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) konnte ein internationales Forschungsteam, an dem unter anderem auch die Universität Hohenheim beteiligt war, drei klimaangepasste Quinoa-Sorten für das peruanische Hochland entwickeln.
Hier geht es:Zurück ins Labor...und zu den anderen Kapiteln









































 Künstliche Intelligenz in der Bioökonomie
Künstliche Intelligenz in der Bioökonomie
 Entdecke die Zukunft von Bioökonomie & KI
Entdecke die Zukunft von Bioökonomie & KI
 Im KI-Labor
Im KI-Labor
 KI in der Fischzucht
KI in der Fischzucht
 Seefisch vom Land
Seefisch vom Land
 Rezirkulierende Kreislaufanlagen
Rezirkulierende Kreislaufanlagen
 Klick auf Play ...
Klick auf Play ...
 FishAI – KI im Einsatz
FishAI – KI im Einsatz
 Laura Bies
Laura Bies
 FishSizer - How big is the fish?
FishSizer - How big is the fish?
 Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
 Zurück ins Labor
Zurück ins Labor
 Materialien der Zukunft
Materialien der Zukunft
 Ein neues, KI-gestütztes Chemieunternehmen
Ein neues, KI-gestütztes Chemieunternehmen
 Mitchell Duffy
Mitchell Duffy
 Design mit Blick auf den Markt
Design mit Blick auf den Markt
 KI als Produktentwickler – Proteine digital designen
KI als Produktentwickler – Proteine digital designen
 Vom Algorithmus ins Labor
Vom Algorithmus ins Labor
 Neues Zeitalter der Materialinnovation
Neues Zeitalter der Materialinnovation
 Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
 Digitaler Zwilling
Digitaler Zwilling
 Prozessoptimierung für biobasierte Produkte
Prozessoptimierung für biobasierte Produkte
 KI-gestützter Entwicklungszyklus
KI-gestützter Entwicklungszyklus
 Hochdurchsatz statt Handarbeit
Hochdurchsatz statt Handarbeit
 "In silico" ersetzt Trial-and-Error
"In silico" ersetzt Trial-and-Error
 Virtuelle Modelle für eine biobasierte Zukunft
Virtuelle Modelle für eine biobasierte Zukunft
 Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
 KI in der Landwirtschaft
KI in der Landwirtschaft
 Schwarmintelligenz für die Pflanzenproduktion
Schwarmintelligenz für die Pflanzenproduktion
 Robotik und KI
Robotik und KI
 Automatisierte Blattinspektion von Nutzpflanzen
Automatisierte Blattinspektion von Nutzpflanzen
 Ökologische Effekte im Blick
Ökologische Effekte im Blick
 Lernfähige Algorithmen für die Biodiversität
Lernfähige Algorithmen für die Biodiversität
 Prof. Dr.-Ing. Ribana Roscher
Prof. Dr.-Ing. Ribana Roscher
 Aus der Forschung in die Praxis
Aus der Forschung in die Praxis
 Mehr zum Thema
Mehr zum Thema