Hauptmenü
Multimedia-Story: Lebensmittel der ZukunftDen Innovationen von heute und den Produkten von morgen auf der Spur🔎
Was bringt die Zukunft? In unserer Kiste befinden sich Produkte, die auf den ersten Blick ganz gewöhnlich aussehen. Hinter ihnen verbergen sich jedoch erstaunliche Geschichten.
Sei neugierig und erfahre, wie Bioökonomie-Forschung zu mehr Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich beitragen kann. Entdecke spannende Innovationen und überraschende Hintergrundinfos. Wie? Einfach nach unten scrollen und auf die einzelnen Produkte klicken!
Das Essen ist serviert!Klicke nacheinander auf alle acht Kacheln, damit du keine spannende Geschichte verpasst
SchoteTotal
SchoteTotal
In dieser Kurzgeschichte geht es um Bioökonomie-Innovationen, die das süße Braun in Zukunft nachhaltiger machen können.
Aber huch, was hat es mit den Pilzen auf sich?
Kakaoschote: nur Schokolade?
Der Anbau sichert das Einkommen von vielen Familien, die mit kleinbäuerlichen Betrieben ihren Lebensunterhalt bestreiten. Für die Plantagen muss jedoch sehr oft Regenwald weichen, der in den Anbaugebieten ohnehin schon stark zurückgedrängt wurde.
Nach der Ernte wird das Innere der Kakaofrucht von der Schale getrennt. Die Kakaobohnen sind von einem weißen Fruchtfleisch, der sogenannten Pulpe, umhüllt.
Kakaofrucht: viel mehr als nur Schokolade!
Das ist aus zweierlei Gründen unglücklich: 1. Die großen Mengen Schale verursachen vor Ort Entsorgungsprobleme und 2. sowohl Pulpe als auch Schale enthalten wertvolle Inhaltsstoffe, die in der Regel einfach verlorengehen. Wie Bioökonomie-Forschung dem entgegenwirken kann, wird auf den folgenden Seiten erklärt.
Das Projekt CocoaFruitGanzheitliche Nutzung von Kakaofrüchten
Bioökonomie für Nachhaltigkeit: Das Projekt CocoaFruit
Verfahrensentwicklung Lebensmittel
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik u. Verpackung IVV
Wurst aus Kakaoschale
Sie ist sehr faserreich, enthält jedoch wenig Protein. Als Nahrungsquelle scheint sie deshalb ungeeignet zu sein – jedoch nur auf den ersten Blick. Mit Verfahren der Bioökonomie kann man die Schale nutzen, um eine vegane, nährstoffreiche Wurstalternative herzustellen.
Die Alchemie der Pilze
Die Multitalente der Bioökonomie wachsen auf der Schale und verwandeln durch biologische Prozesse, die sogenannte Fermentation, die Fasern in für uns wertvolles Protein.
Doch wie genau wird daraus nun eine vegane Wurst?
Die Forschung dahinter
PilzwurstWie genau werden im Projekt CocoaFruit Pilze genutzt, um aus den Kakaoschalen vegane Wurst herzustellen?
Kakaopulpe – die unbekannte Delikatesse
In den Anbauländern wird ein kleiner Teil von den großen Mengen, die bei der Ernte anfallen, zu Säften und Konfitüren verarbeitet.
In Europa ist die fruchtige Pulpe weitestgehend unbekannt. Das liegt vor allem daran, dass sie schnell verdirbt und deshalb für den Transport ungeeignet ist. Doch Forschende sind Lösungen auf der Spur…
Die Forschung dahinter
Sozioökonomische Vorteile
Post Harvest Technology
Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute (ICCRI)
Mehr zum ThemaWeiterführende Beiträge und Videos

CocoaFruit Projektseite
Mehr Informationen rund um das Projekt CocoaFruit
CocoaFruit: Projektfilm
Hier gibt es den gesamten Kurzfilm zum Projekt CocoaFruit.
bioökonomie.de: Zuckerrübenreste für die Bioraffinerie
Auch einheimische Reststoffe können im Sinne der Bioökonomie nachhaltig verwertet werden. Die Reste von Zuckerrüben können beispielsweise in Bioraffinerien verarbeitet werden.
bioökonomie.de - Schokolade aus mikrobieller Produktion
Das Münchner Start-up NxFoods will eine pflanzenbasierte Schokolade entwickeln, die wie das Original schmeckt, aber ohne Kakao auskommt und nachhaltig produziert ist.
KulturFisch
KulturFisch
Doch der Schein trügt! Denn: Was wächst denn da? Und wie genau?
Immer mehr Fleisch für immer mehr MenschenFleischkonsum steigt weltweit an
(Quelle: Our World in Data; Angaben in Tonnen)
Der Umweg über das Tier
Das ist kein so großes Problem, wenn es sich dabei um Pflanzen handelt, die wir selbst nicht essen können, wie etwa das Gras auf Weiden. Wenn es sich jedoch um Getreide und Hülsenfrüchte handelt, die wir Menschen auch direkt essen könnten, steht die Tierhaltung in direkter Konkurrenz zu einer pflanzlichen Ernährung.
Denn die weltweiten Flächen, die sich für den Anbau von Nutzpflanzen eignen, sind begrenzt.
Fleisch ohne Tier?
Fisch aus Aquakultur
Fisch aus Zellkultur
Kultivierte ZellenDie Suche nach geeigneten Zelllinien
Für den Erfolg spielen dabei viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der sich die Zellen teilen, wie viele Nährstoffe sie dafür brauchen, wie sehr sie sich mit der Zeit genetisch verändern und zu welcher Art von Gewebe sie sich schließlich entwickeln.
Kultivierte ZellenDie Suche nach geeigneten Zelllinien
Die Forschung dahinterDie Suche nach geeigneten Zellen
Co-Founder
Bluu Biosciences
Auch Zellen müssen essenNährmedium und Wachstumsfaktoren
Zellulärer Strukturwandel Was macht die Textur von Fleisch aus?
Die Zellen lagern sich dafür auf eine ganz bestimmte Weise an, und Nervenaktivität sorgt für Kontraktion, sodass sich ein richtiger Muskel ausbildet. In einer gewöhnlichen Zellkultur geschieht all das nicht von alleine. Es gibt unterschiedliche Ansätze, den für die Textur von echtem Fleisch nötigen Strukturwandel hervorzurufen. Zum Beispiel lässt man Zellen in einem Gerüst wachsen, was sie zur Ausbildung einer faserigen Struktur stimuliert. Diese "Stützstruktur" könnte essbar sein oder von den Zellen am Ende des Wachstums resorbiert werden.
Die Forschung dahinterTextur
Co-Founder
Bluu Biosciences
Top oder Flop?Akzeptanz von Fleisch aus Zellkultur
Deshalb gibt es Forschende, die sich mit dem Bereich der Akzeptanz genauer auseinandersetzen.
Die Forschung dahinterAkzeptanz - Was denken die Menschen über Fleisch aus Zellkultur?
Professur für Wirtschaft und Ethik
Universität Vechta
Was bringt die Zukunft?

Akzeptanz neuartiger Lebensmittel – Hochschulwettbewerb 2020
Eines der Gewinnerteams des Hochschulwettbewerbs 2020 forscht an der Uni Osnabrück zur Akzeptanz von Fleisch aus Zellkultur.
bioökonomie.de - Biopionier Raffael Wohlgensinger
Mit seinem Start-up Formo will Raffael echten Käse mit Mikroorganismen statt mit Kühen produzieren.
Laborfleisch: Eine Revolution!
In einer Folge des DLG-Mitteilungen
Podcasts
spricht Prof. Dr. Nick Lin-Hi über die Chancen von Fleisch aus Zellkultur.
bioökonomie.de - Express, Folge 24
Hier den gesamten Erklärfilm zu Fleisch auf Zellkultur ansehen.
bioökonomie.de - Biopionier Sebastian Rakers
Der Laborfischer Sebastian Rakers will mit seinem Start-up "Bluu Seafood" seine Vision Realität werden lassen: Echter Fisch aus Zellkultur, statt aus dem Meer.
NudelZüchtung
NudelZüchtung
In puncto Vielfalt gibt es bei Spaghetti & Co. aber noch einiges mehr zu entdecken!
NudelZüchtung
Die Geschichte der Pasta ist eine kulturelle – aber auch eine genetische. Woraus besteht sie eigentlich, was hat sie mit Genen zu tun und wie hat Pflanzenzüchtung sie zu dem gemacht, was sie heute ist?
Eine lange GeschichteVom wilden Emmer zum modernen Hartweizen
Das detaillierte Wissen darüber ist der Entschlüsselung des Hartweizengenoms zu verdanken. Durch gezielte Auswahl und Vermehrung von Emmer-Pflanzen mit mehr und größeren Samen formten die Menschen das Genom der Pflanze in eine bestimmte Richtung.
So wurde aus einem unscheinbaren Gras ein Getreide mit großen Ähren und Körnern, aus denen man Brot backen und später Nudeln herstellen konnte.
Mutationen als Basis von Vielfalt
Dieser natürliche Vorgang wird bei allen Züchtungsprozessen genutzt. Indem man Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften gezielt aussucht, vermehrt und miteinander kreuzt, wird auch ihr Genom in eine bestimmte Richtung verändert. Ein sehr prägnantes Beispiel für diese Veränderung durch Züchtung sind die unterschiedlichen Kohlsorten, die allesamt aus demselben Vorfahren gezüchtet wurden – dem Wildkohl.
Vielfältige Lebensmittel Mutationen als Ressource
Wo genau auf der DNA sich diese Mutationen befinden werden, war unbekannt. Doch auf diese Weise wurden mehrere tausend neue Sorten gezüchtet. Eine Reihe davon finden wir heute in den Obst- und Gemüseregalen unserer Supermärkte vor. Und im Nudelregal, denn viele Hartweizensorten, aus deren Nachkommen man auch heute noch Nudeln herstellt, basieren auf dieser Art der Mutationszüchtung.
Züchtung heuteDie Bedeutung der Pflanzenforschung
Pflanzenforschung an zahlreichen Universitäten und Instituten spielt dabei eine wichtige Rolle, auch um Landwirtschaft und Bioökonomie insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Da die genetischen Eigenschaften der Pflanzen dafür die Grundlage darstellen, sind das wachsende Wissen über Gene, ihre Funktionen und ihr Zusammenwirken miteinander und mit der Umwelt von großer Bedeutung.
Die Forschung dahinter
Doktorand
Pflanzliche Reproduktionsbiologie
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenfirschung (IPK) Gatersleben
Die Forschung dahinterEin junger Pflanzenforscher stellt sich vor
Die Forschung dahinterDie Genschere in der Pflanzenzüchtung
Das Archiv der GeneGenetische Vielfalt als Ressource der Zukunft
In sogenannten Genbanken, wie dieser hier am IPK Gatersleben, werden deshalb Sorten gesammelt, archiviert und erhalten. Auf diese Weise entsteht ein umfangreiches Archiv an genetischer Vielfalt, die als wichtige Ressource für eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft dient.

bioökonomie.de - Genom des Wilden Emmers entschlüsselt
Der Wilde Emmer ist der Urahn unserer Kulturpflanze Weizen. Ein internationales Forscherteam hat das Genom des Getreides sequenziert.
bioökonomie.de - Genbanken digital vernetzen
Genbanken
sind wertvolle Archive der biologischen Vielfalt und sollen besser vernetzt werden.
Pflanzenforschung 4.0
Auf diesen Seiten des Cluster of Excellence on Plant Science (CEPLAS) wird Pflanzenforschung multimedial erklärt.
bioökonomie.de - Der Biopionier Robert Hoffie
Robert Hoffie forscht an Gerste und mit der Genschere CRISPR/Cas9.
SchallSalat
SchallSalat
Welche biobasierten Innovationen sich hinter dem krausen Grün verbergen, erfährst du in dieser Kurzgeschichte.
Vom Feld bis auf den Teller
Damit ist aber noch nicht genug. Weitere Waschgänge sind notwendig, um möglichst viele Keime von seiner Oberfläche zu entfernen. So bleibt er länger frisch.
Wird Salat jedoch geschnitten, entstehen viele neue Oberflächen und damit Eintrittstore für Keime und Verunreinigungen. Die Konsequenz? Vorgeschnittener Salat sollte zu Hause noch einmal gründlich gewaschen werden.
Vom Feld bis auf den Teller ist der Verbrauch an Wasser deshalb bei Salat relativ groß.
Mit Schall waschen?
Eine Möglichkeit: Ultraschall einsetzen. Bisher kommt dieser zum Beispiel für die effektive Reinigung von Metall zum Einsatz. Kann das auch bei Salat & Co. funktionieren?
Das Projekt MultiVegiClean
M.Sc. Jens Schröder
Abteilungsleiter Automatisierungstechnik
DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V.
Eine Waschstraße für Salat
Weniger Pestizide, weniger Nitrat
Die Forschung dahinter
M.Sc. Jens Schröder
Abteilungsleiter Automatisierungstechnik
DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V.
Innovation spart Ressourcen
Dies trifft auch auf essbare Pflanzenbestandteile zu, die ansonsten häufig im Biomüll landen. Auf diese Weise verringert sich die Lebensmittelverschwendung und der gesundheitliche Nutzen steigt an.

bioökonomie.de - Salatanbau in Hydroponik
Es gibt neue Ansätze, mit denen Salat und Kräuter auch ohne Acker und mitten in der Stadt angebaut werden können.
bioökonomie.de - Kreislaufsysteme
Aus Abwässern können wertvolle Nährstoffe rückgewonnen werden, die zur Aufzucht von Pflanzen als Dünger dienen können. Ein solcher Kreislauf kann Energie und Rohstoffe einsparen.
bioökonomie.de - Paprikablätter nutzen
Auch die Blätter von Paprikapflanzen landen in der Regel auf dem Kompost. Man kann sie zwar nicht essen, doch gibt es andere innovative Verwendungsmöglichkeiten für sie.
StadtSpeisen
StadtSpeisen
Scrolle weiter und erfahre mehr über das Meeresgemüse und drei weitere Lebensmittel-Exoten, die den Herausforderungen einer nachhaltigen Ernährung gewachsen sind.
Bald 10 Mrd. Menschen ernähren
Wie können wir 2050 10 Mrd. Menschen auf nachhaltige Weise mit frischen, gesunden Lebensmitteln in ausreichender Menge ernähren?
Wie kann das gelingen, wenn immer mehr von ihnen in Groß- und Mega-Städten leben – abseits von Äckern, mit abnehmenden Niederschlagsmengen und mit ansteigenden Temperaturen?
Wie sieht die Lösung aus?
Einen davon nehmen wir näher in den Blick. Er ist Teil des Forschungsprojektes food4future. Worum es bei dem Vorhaben geht, erklärt Projektkoordinatorin Prof. Dr. Monika Schreiner.
Projekt-Portrait
Das steckt hinter dem Verbundprojekt food4future – Nahrung der Zukunft (f4f), gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms Agrarsysteme der Zukunft.
Prof. Dr. Monika Schreiner
Koordinatorin food4future
Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ)
1. Future Food – Queller
Damit entschärft der Anbau von Queller und von anderen Halophyten (salztolerante Pflanzen) die Konkurrenz um fruchtbares, knappes Ackerland. Hinzu kommt, dass er voller wichtiger Nährstoffe steckt, z. B. Kalium, Magnesium und Jod.
Rezeptidee!Spaghetti Carbonara mit Queller
3. Future Food – Quallen
Julia Vogt
Projektmanagerin food4future
Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ)
4. Future Food – Grillen
Zudem enthalten sie besonders viel Protein, ungesättigte Fettsäuren sowie diverse Mineralstoffe und Vitamine. Aus ihrem Mehl lassen sich z. B. herzhafte Burgerpatties herstellen oder Nudeln anreichern; mit Schokolade überzogen sorgen die Grillen für einen Protein-Kick am Nachmittag zum Kaffee.
Ein weiterer Pluspunkt in puncto Nachhaltigkeit liegt in ihrer Funktion als Reststoffverwerter.

bioökonomie.de: Agrarsysteme der Zukunft (Dossier)
Acht große Projektkonsortien erforschen bundesweit, wie die
landwirtschaftliche Produktion von morgen aussehen könnte.
Die Biopioniere: Der Algenbauer (Video)
Maarten Heins ist junger Landwirt in sechster Generation. Gemeinsam mit seinem Vater züchtet er neben Tieren auch Mikroalgen.
Zoom: Fliegende Proteinquellen (Video)
Heinrich Katz von der Hermetia Baruth GmbH in Brandenburg züchtet die Schwarze Soldatenfliege. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Video.
biooekonomie.de: Quallen – jetzt noch leckerer
Chemiker vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung haben die traditionelle Zubereitung der Meerestiere analysiert und eine schnellere Alternative entwickelt.
WasserWachstum
WasserWachstum
Das Projekt SUSKULT
Projektkoordination
Fraunhofer UMSICHT
Wachsen ohne Erde
Doch es gibt gute Gründe, Pflanzen stattdessen in Wasser wachsen zu lassen: Im Gegensatz zu Erde ist Wasser ein homogenes Medium. Das heißt, Nährstoffgehalt, ph-Wert und andere Parameter sind im Wasser sehr gleichmäßig verteilt und lassen sich sehr gut kontrollieren. Dadurch können Ressourcen gespart und Erträge gesteigert werden.
Die Forschung dahinterHydroponik
Projekt SUSKULT
Hochschule Osnabrück
Boden wird knappVorteile der Hydroponik
Alles unter KontrolleEffiziente Lichtsysteme
Neue Lichtsysteme können hingegen für optimale Bedingungen sorgen. So ist nicht nur die Umgebung der Wurzeln, sondern auch die der Blätter, Blüten und Früchte kontrollierbar.
Die Forschung dahinter
Projekt SUSKULT
Hochschule Osnabrück
Urban und regionalLebensmittelversorgung in den Städten der Zukunft
Auch mit dieser Herausforderung beschäftigt sich die Forschung...
Die Forschung dahinter
Projekt SUSKULT
Hochschule Osnabrück

SUSKULT - Projektseite
Hier geht es zur Seite des Projektes SUSKULT.
bioökonomie.de - Zoom, Folge 33
Der ganze Film zum Projekt SUSKULT
bioökonomie.de - Salatanbau in Hydroponik
Es gibt neue Ansätze, mit denen Salat und Kräuter auch ohne Acker und mitten in der Stadt angebaut werden können.
biooekonomie.de – 5 Fakten zu Aquaponik
Aquaponik ist eine spezielle Form der Aquakultur, in der die Aufzucht von Fischen mit dem Anbau von Pflanzen kombiniert wird.
AromenJagd
AromenJagd
Was Bioökonomie und Fermentation damit zu tun haben, und wer da was jagt, erfährst Du in dieser duften Geschichte.
Die Welt der Aromen
Auch bei Lebensmitteln spielen sie deshalb eine zentrale Rolle. Erzeugt werden Geruch und Geschmack durch Moleküle mit bestimmten Strukturen. Besonders Mikroorganismen sind gut darin, eine immense Vielfalt solcher Moleküle zu produzieren, indem sie einen Ausgangsstoff in ein Aroma umwandeln. Diesen Vorgang nennt man Fermentation.
Die Forschung dahinterBioökonomie und Fermentation am Fraunhofer CBP in Leuna
FermentationVon einer Tradition zur Zukunftstechnologie
Die durch die Molekularbiologie möglich gewordene, gezielte Veränderung dieser Mikroorganismen eröffnet auch für Fermentation ganz neue Möglichkeiten.
Die gezielte Veränderung von Fermentationsprozessen mit molekularbiologischen Methoden nennt man auch "precision fermentation", also Präzisionsfermentation.
Die Jagd nach Aromen
Das Projekt AROMAplusAuf Jagd nach Aromen
Institut für Mikrobiologie und Biochemie
Hochschule Geisenheim University
(Foto- und Videoaufnahmen: Sascha Mannel)
Expeditionen in den Mikrokosmos
Durch neueste Technologien ist es möglich, die Welt der Mikroorganismen in ihrer Gänze zu kartieren und nach und nach zu erforschen. Vor allem die rasante Weiterentwicklung der Sequenzierung von DNA führt zu Durchbrüchen. Dadurch wird eine kaum zu ermessende Quelle an biologischer und chemischer Vielfalt zugänglich.
Die chemische Welt der DüfteChemische Multitalente: Die Thiole
Doktorand im AROMAplus Projekt
Institut für Mikrobiologie und Biochemie
Hochschule Geisenheim University
(Foto- und Videoaufnahmen: Sascha Mannel)
Schlummernde Aromen
Forschende haben herausgefunden, dass dafür unter anderem auch Mikroorganismen verantwortlich sind, die auf der Oberfläche der Trauben leben. Diese könnte man nutzen, um natürliche Aromen für andere Lebensmittel wie Limonade zu entwickeln.
Die Forschung dahinterSchlummernde Aromen
Felix Graf
Doktorand im AROMAplus Projekt
Mikrobielle Biotechnologie
DECHEMA-Forschungsinstitut
PräzisionsfermentationMikroorganismen für eine maßgeschneiderte Produktion
Zum Beispiel kommt das Aroma Vanillin in einer seltenen und schwierig zu kultivierenden Orchideenart vor. Die genetische Information für die Produktion des Aromas kann in einen Mikroorganismus überführt werden. So kann es in größeren Mengen produziert werden, ohne die Pflanze ernten zu müssen. Andere Anwendungsbeispiele für Präzisionsfermentation sind die Herstellung von Milchprotein und -zucker mit Mikroorganismen statt Kühen oder die Produktion von Medikamenten.
Das Projekt FeruBaseDurch Fermentation Aromen präzise produzieren
Ziel ist es, für die Produktion von Aromen nicht mehr auf Pflanzen oder Erdöl angewiesen zu sein. Das könnte Biodiversität und Klima schonen und Ressourcen sparen.
Die Forschung dahinterMit Präzisionsfermentation Aromen herstellen
Dr.-Ing. Tino Elter
Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP
Der Ort des GeschehensDrohnenflug durch eine Bioraffinerie
Innovation schafft Vielfalt
Auch Biotechnologie könnte eine immer wichtigere Rolle spielen, um natürliche Aromen noch präziser nachzuahmen und sogar identisch zu produzieren. Das könnte Ressourcen sparen und die Aromen in unseren Lebensmitteln noch vielfältiger machen.

bioökonomie.de - Themendossier: Mikrobielle Zellfabriken
Aminosäuren, Insulin, Enzyme, Zitronensäure: Diese Industrieprodukte
werden meist von Mikroorganismen hergestellt.
Wissenschaftsjahr - CoLab: Das Community Lab
Fermentation ist nicht nur etwas für die Industrie. Auch für zu Hause gibt es neue Ideen zum selbermachen. Zum Beispiel eine Anleitung, um die Blaualge Spirulina auf der Fensterbank zu züchten.
Das Projekt FeruBase
Hier finden sich mehr Informationen rund um das Projekt FeruBase am Fraunhofer CBP.
Das Projekt AROMAplus
Hier finden sich mehr Informationen rund um das Projekt AROMAplus.
PflanzenFleisch
PflanzenFleisch
Um diese um andere Fragen geht es in dieser Episode.
Die Vielfalt der Proteine
Seit einigen Jahren kommen jedoch verschiedenste neue Proteinquellen auf den Markt: Neben Hülsenfrüchten spielen auch ausgefallene Proteinquellen wie Algen und Insekten eine wachsende Rolle. Doch welches Protein eignet sich für welches Produkt am besten?
Die unterschiedlichen Eigenschaften dieser wachsenden Zahl alternativer Proteinquellen sind bisher zu wenig untersucht und nicht katalogisiert.
Das Projekt Nachhaltige ProteinzutatenProteine sammeln und charakterisieren
Warum eigentlich Proteine?Komplexe Moleküle mit großer Bedeutung
Auch für uns sind sie deshalb essentiell und wir müssen über die Nahrung ausreichend Proteine aufnehmen, damit unser Körper eigene produzieren kann. Dabei sind nicht alle Proteine gleich wertvoll für unsere Ernährung. Die höchste "biologische Wertigkeit" haben tierische Proteine für uns, denn ihr Aufbau ähnelt dem unserer eigenen Proteine am meisten. Doch auch ein ausgewogener Konsum nicht-tierischer Proteinquellen kann unseren Bedarf decken.
Die Forschung dahinter
Prof. Dr. Ute Weisz
Projektleiterin
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Wie wird aus Pflanzen Fleisch?
Tierische Proteine hingegen liegen in Muskeln "fibrillär", also als Fasern vor. Fleisch bekommt dadurch seine typische faserige Textur.
Dank Innovation im Bereich der Bioökonomie ist es inzwischen möglich, pflanzlichen Proteinen eine faserige Textur zu verleihen.
Die Forschung dahinterPflanzenproteinen die richtige Struktur geben
Nachhaltigkeit erforschenSind Fleischalternativen unbedingt nachhaltiger?
Doch Nachhaltigkeit hat viele Dimensionen und es ist nicht einfach zu ermitteln, ob ein alternatives Lebensmittel letztendlich nachhaltiger ist als ein konventionelles. Deshalb wird auch daran geforscht, ob innovative Produkte aus alternativen Proteinquellen wirklich die besser Wahl sind.
Die Forschung dahinterKriterien für Nachhaltigkeit
Projektleiterin "Nachhaltige Proteinzutaten" des Innovationsraumes NewFoodSystems
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Innovation ermöglicht Nachhaltigkeit
Pflanzliche Proteinquellen verbrauchen für ihre Produktion weniger Fläche. Manche, wie z. B. Algen oder Hydrokultur-Pflanzen, können sogar ganz ohne Erde angebaut werden. Innovative Verfahren können dazu beitragen, dass uns Produkte mit den neuen Proteinquellen vertrauter werden und gut schmecken.
Welche dieser Alternativen unser Ernährungssystem tatsächlich nachhaltiger machen werden, ist ebenfalls Teil der Bioökonomie-Forschung.

bioökonomie.de - Express, Folge 23 – Veganes Fleisch
Vegane Alternativen zum Fleisch als Eiweißquelle liegen im Trend. Wir stellen proteinreiche, pflanzliche Alternativen vor und erklären, wie sie hergestellt werden.
New Food Systems - Nachhaltige Proteinzutaten
Hier geht es zur Projektseite des BMBF-geförderten
Innovationsraums NewFoodSystems.
bioökonomie.de - Biertreber als Mehlersatz
Saarbrücker Forschende zeigen, welches Potenzial Biertreber für eine gesunde und nachhaltige Nahrungsmittelproduktion im Sinne der Kreislaufwirtschaft haben könnte.
ProteinBioTech - Proteinversorgung zwischen Biopolitik und Biotechnologie
Ein soziologisches Forschungsprojekt für die Entwicklung einer nachhaltigen und gesundheitsfördernden Ernährungskultur an der TU Darmstadt.

























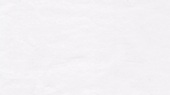































































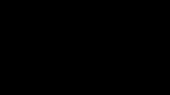







 Multimedia-Story: Lebensmittel der Zukunft
Multimedia-Story: Lebensmittel der Zukunft
 Das Essen ist serviert!
Das Essen ist serviert!

 SchoteTotal
SchoteTotal
 Kakaoschote: nur Schokolade?
Kakaoschote: nur Schokolade?
 Kakaofrucht: viel mehr als nur Schokolade!
Kakaofrucht: viel mehr als nur Schokolade!
 Bioökonomie für Nachhaltigkeit: Das Projekt CocoaFruit
Bioökonomie für Nachhaltigkeit: Das Projekt CocoaFruit
 Wurst aus Kakaoschale
Wurst aus Kakaoschale
 Die Alchemie der Pilze
Die Alchemie der Pilze
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Pilzwurst
Pilzwurst
 Kakaopulpe – die unbekannte Delikatesse
Kakaopulpe – die unbekannte Delikatesse
 Vielfalt durch Innovation
Vielfalt durch Innovation
 Sozioökonomische Vorteile
Sozioökonomische Vorteile
 Zurück zum Menü
Zurück zum Menü
 KulturFisch
KulturFisch
 Immer mehr Fleisch für immer mehr Menschen
Immer mehr Fleisch für immer mehr Menschen
 Der Umweg über das Tier
Der Umweg über das Tier
 Fleisch ohne Tier?
Fleisch ohne Tier?
 Fisch aus Aquakultur
Fisch aus Aquakultur
 Fisch aus Zellkultur
Fisch aus Zellkultur
 Kultivierte Zellen
Kultivierte Zellen
 Kultivierte Zellen
Kultivierte Zellen
 Auch Zellen müssen essen
Auch Zellen müssen essen
 Zellulärer Strukturwandel
Zellulärer Strukturwandel
 Top oder Flop?
Top oder Flop?
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Was bringt die Zukunft?
Was bringt die Zukunft?
 NudelZüchtung
NudelZüchtung
 NudelZüchtung
NudelZüchtung
 Eine lange Geschichte
Eine lange Geschichte
 Mutationen als Basis von Vielfalt
Mutationen als Basis von Vielfalt
 Vielfältige Lebensmittel
Vielfältige Lebensmittel
 Züchtung heute
Züchtung heute
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Gezielter züchten durch genaueres Lesen
Gezielter züchten durch genaueres Lesen
 Gezielter züchten durch präzises Schneiden
Gezielter züchten durch präzises Schneiden
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Das Archiv der Gene
Das Archiv der Gene
 SchallSalat
SchallSalat
 Vom Feld bis auf den Teller
Vom Feld bis auf den Teller
 Mit Schall waschen?
Mit Schall waschen?
 Das Projekt MultiVegiClean
Das Projekt MultiVegiClean
 Eine Waschstraße für Salat
Eine Waschstraße für Salat
 Weniger Pestizide, weniger Nitrat
Weniger Pestizide, weniger Nitrat
 Verschmähte Blätter
Verschmähte Blätter
 Innovation spart Ressourcen
Innovation spart Ressourcen
 StadtSpeisen
StadtSpeisen
 Bald 10 Mrd. Menschen ernähren
Bald 10 Mrd. Menschen ernähren
 1. Future Food – Queller
1. Future Food – Queller
 Rezeptidee!
Rezeptidee!
 2. Future Food – Algen
2. Future Food – Algen
 3. Future Food – Quallen
3. Future Food – Quallen
 4. Future Food – Grillen
4. Future Food – Grillen
 Und so soll es gelingen
Und so soll es gelingen
 WasserWachstum
WasserWachstum
 Das Projekt SUSKULT
Das Projekt SUSKULT
 Wachsen ohne Erde
Wachsen ohne Erde
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Boden wird knapp
Boden wird knapp
 Alles unter Kontrolle
Alles unter Kontrolle
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Urban und regional
Urban und regional
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 AromenJagd
AromenJagd
 Die Welt der Aromen
Die Welt der Aromen
 Mikroorganismen am Werk
Mikroorganismen am Werk
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Fermentation
Fermentation
 Die Jagd nach Aromen
Die Jagd nach Aromen
 Das Projekt AROMAplus
Das Projekt AROMAplus
 Expeditionen in den Mikrokosmos
Expeditionen in den Mikrokosmos
 Die chemische Welt der Düfte
Die chemische Welt der Düfte
 Schlummernde Aromen
Schlummernde Aromen
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Präzisionsfermentation
Präzisionsfermentation
 Das Projekt FeruBase
Das Projekt FeruBase
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Der Ort des Geschehens
Der Ort des Geschehens
 Innovation schafft Vielfalt
Innovation schafft Vielfalt
 PflanzenFleisch
PflanzenFleisch
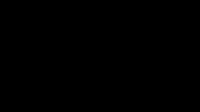 Die Vielfalt der Proteine
Die Vielfalt der Proteine
 Das Projekt Nachhaltige Proteinzutaten
Das Projekt Nachhaltige Proteinzutaten
 Warum eigentlich Proteine?
Warum eigentlich Proteine?
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Wie wird aus Pflanzen Fleisch?
Wie wird aus Pflanzen Fleisch?
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Die Forschung dahinter
Die Forschung dahinter
 Innovation ermöglicht Nachhaltigkeit
Innovation ermöglicht Nachhaltigkeit